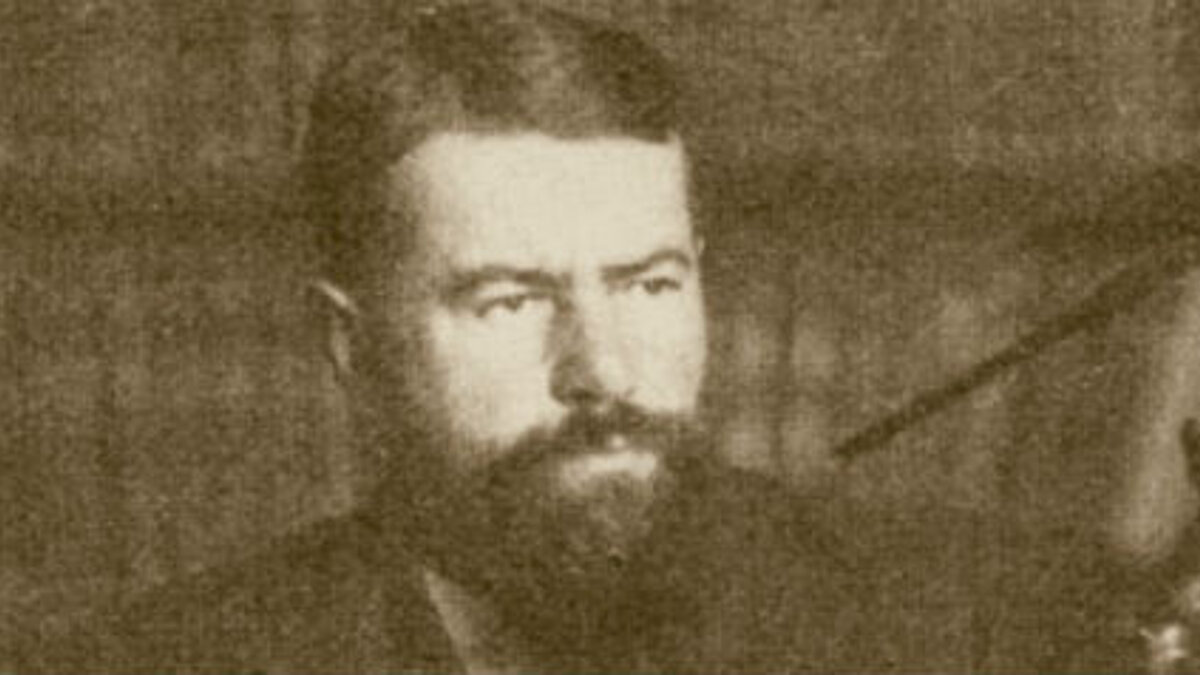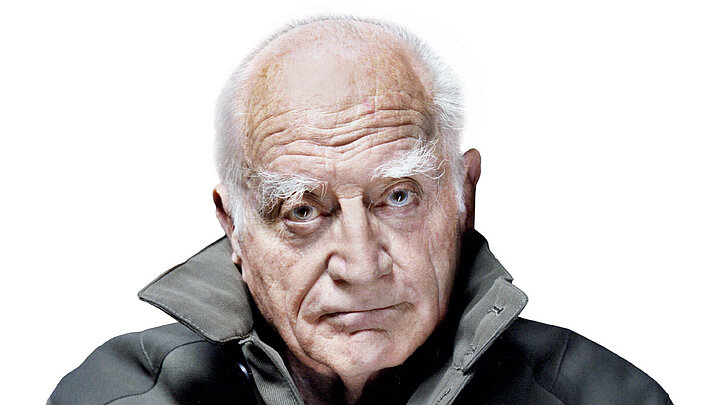Max Weber um 1907 | Quelle: Wikipedia
Der Geist der protestantischen Ethik
Max Weber zum 150. Geburtstag kulinarisch gedacht
„Amerika isst fad.“ Als der große französische Philosoph Michel Serres 1985 in seinem Band „Die fünf Sinne“ diese Feststellung tätigte, war sie so zutreffend wie für deutsche Wissenschaftler seinerzeit irritierend. Sollte man sich tatsächlich grundlegende Gedanken über das Essen machen? Gerade begann man sich mit Foucaults „Sexualität und Wahrheit“ auseinanderzusetzen, da galt der Blick auf den Magen, die Verdauung und den Geschmack als zu lebensweltlich und damit einer philosophischen Betrachtung nicht würdig. Dies ändert sich auch nicht durch die Rezeption des Werkes eines weiteren französischen Soziologen: „Die feinen Unterschiede“ von Pierre Bourdieu, das schon einige Zeit früher erschienen war, aber erst zögerlich in Deutschland rezipiert wurde.
Nun, vierzig Jahre nach dem Diktum, wonach man in Amerika fad isst und daher die geschmackliche Qualität durch fade Quantität auszugleichen versuche, würde Michel Serres – trotz weiter bestehendem Problems der Übergewichtigkeit in Amerika – sicherlich zu einer anderen Schlussfolgerung kommen. Unübersehbar die Zahl der Sternerestaurants in den USA, die Entstehung von Wochenmärkten, die Wertschätzung von biologischen Lebensmitteln und der Trend zu abwechslungsreicher Nahrung jenseits von Junk-Food.
Protestantismus als Nährboden des Kapitalismus
In seinem vor 110 Jahren erschienenen aufsehenerregenden Werk „Der Geist der protestantischen Ethik“ geht Max Weber der Frage nach, weshalb sich der Kapitalismus gerade in protestantischen Ländern etablieren und besser ausbreiten konnte. Dabei sieht er im Protestantismus die kulturelle Folie, welche dem Kapitalismus das nötige Rüstzeug an Rationalisierung, Mechanisierung der Arbeits-, Denk- und Lebensweisen liefert. Umgekehrt avanciert der Kapitalismus zur Leitfeder des Utilitarismus. Mitmenschlichkeit wird nun nicht mehr in den Kategorien eines sozialen Miteinanders verstanden, sondern in Kategorien der jeweils eigenen Produktivität gedacht. Leistungsfähigkeit und Frömmigkeit wechseln sich nicht ab, sondern bedingen sich fortan wechselseitig. Ein gottgewolltes Leben ist eines der Produktion. Die Produktion von Geld und Reichtum selbst avanciert zur gottgefälligen Lebensweise. Kein Wunder, könnte man sagen, dass auf dem Geld selbst, dem Dollar das Glaubensbekenntnis „In God we trust“ steht. Das Geld wird zur Hostie des Protestantismus, die – den Regeln des Protestantismus unterworfen – nicht verzehrt sondern vermehrt werden soll. Erst durch den Siegeszug des Kapitalismus in protestantischen Ländern wie den Vereinigten Staaten, England, den Niederlanden und Regionen in Deutschland sowie der Schweiz, kann die Umerziehung der katholisch geprägten Menschen im Hinblick auf einen geldwerten Mehrwert der täglichen Arbeit gerichtet werden. Die Menschen arbeiten nun nicht mehr das Nötigste, die Arbeit selbst wird zu einem Wert an sich. Die kapitalistische Denk- und Arbeitsweise frisst sich in den Katholizismus ein. Zeit ist nicht mehr im Überfluss zu haben, sondern wird zu einem seltenen Gut, da sie gottgefällig also produktiv eingesetzt werden soll. Der Genuss Zeit zu haben, wie die Zeit zum Genuss zu haben wird durch den Gedanken der sündhaften Trägheit wie durch ein tumorartiges gedankliches Kokon eingebunden.
Die neue Wissenschaft des Essens
Kulinarisch gewendet könnte man den Geist der protestantischen Ethik als Begnügsamkeit in Maß und Zubereitung ausdrücken. Maßlosigkeit galt dem Protestantismus als eine der Todsünden – was sich im Essen vor allem in Schlichtheit der Zubereitung und sparsame Verwendung von Gewürzen ausdrückte: Wenn Gott einem durch die Finger schauen kann, dann sicherlich auch durch die Spitzen einer von Hand geführten Gabel – um an dieser Stelle von der calvinistischen Zuspitzung dieser Spielart, dass auch die Gedanken für Gott ersichtlich sind, gar nicht erst zu reden. Zurückhaltung und Verzicht auf sinnlichen Genuss prägten das protestantische Essen: Pfannkuchen und Maisbrot, Pellkartoffeln mit Quark und Leinsamenöl gelten in vielen protestantisch geprägten Regionen heute noch als Inbegriff der angenehmen Ernährung. Gerichte, welche wie Porridge oder Haggis einem Katholiken nur in Zeiten strengster Fastengebote zu Munde kommen würde.
Kein Wunder also, dass die großen Küchen Europas die Französische und die Italienische katholisch geprägt sind. Doch scheint der Geist der protestantischen Ethik nach seiner wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte Geschmack am Erfolg gefunden zu haben, um nun den Geschmack erfolgreich verarbeiten zu können. 1985 zur Zeit des Diktums Serres wäre es sicherlich undenkbar gewesen anzunehmen, dass skandinavische oder andere protestantisch geprägte Staaten einmal eine kulinarische Vorreiterrolle einnehmen würden.
Den Genuss selbst produktiv werden lassen
Auch wenn man sich über den Aussagegehalt von Ranglisten streiten darf, die versuchen die weltbesten Restaurants nicht nur zu registrieren, sondern zu bewerten, so kann man doch feststellen, dass die Vormacht der Restaurants aus katholisch geprägten Ländern nicht mehr eindeutig gegeben ist. Im Gegenteil: Mit dem „Noma“ aus Kopenhagen belegt immer wieder ein Restaurant eines protestantischen Landes einen der vorderen Ränge. Doch nicht nur das: auch bei den Nachwuchswettbewerben wie dem Bocuse d´Or laufen die skandinavischen Köche den Konkurrenten scheinbar den Rang ab.
Vielleicht ist diese Entwicklung einem kulinarischem Umbruch geschuldet, der dem zu Beginn der Neuzeit nicht unähnlich ist. Es war kein Geringerer als Ferran Adrià, der mit seiner als Molekularküche apostrophierten Kochkunst, den Raum der Kochmöglichkeiten aufzeigte, sobald die Köche gewillt sind, den Pfad der scholastisch wirkenden klassischen Küche zu verlassen. Auch in diesem Fall sind es, wie zum Ende des Mittelalters die Methoden der Wissenschaft und der Aufhebung von engen Denkbildern, welche dieser Neuerung zu Grunde liegen. Und sicherlich ist es kein Zufall, dass mit René Redzepi dem „Noma“ ein Koch vorsteht, der nicht nur auf eine klassisch französische Ausbildung sondern zu dem auf eine intensive Lehrzeit bei Ferran Adrià verweisen kann. Von Adrià übernimmt er zwei elementare Dinge: eine innovative Küche kennt keine Grenzen und will eine Küche überraschen, muss sie wissenschaftlich betrieben sein und über ein Gedächtnis verfügen. Dieses Gedächtnis sitzt in einem Hausboot schräg gegenüber dem Noma, wo Redzepi ein „Nordic Food Lap“ eingerichtet hat. Hier werden Möglichkeiten des Flavour Pairings ebenso erörtert, wie neue Kreationen für das Restaurant. Hier wird aber auch zugleich an Übermorgen gedacht: wie entwickelt sich das Essverhalten der Menschheit? Wie kann man in der Spitzengastronomie Denkanstöße geben, um zu zeigen, welche Realitäten der Speiseteller von Morgen im Bistro bieten wird.
Redzepi ist nicht nur Vorreiter der Nordic Nova Regio Küche, sondern sieht sich als Koch in einer politischen Verantwortung: Wie können wir die Ressourcen vor unserer Tür kulinarisch nutzen, wie können wir beispielsweise Mose, Farne oder andere Gewächse, die wir meist noch nicht mal mit Namen bezeichnen können, kulinarisch veredeln und auf den Teller bringen? Hier geht Redzepi radikale neue Wege. Regionalität meint bei ihm tatsächlich: kurze Wege. Auch und gerade in einer eher kargen nördlichen Region. Doch der Ansatz geht weiter: kann man Insekten in der westlichen Spitzengastronomie etablieren, um sie auf diesem Wege auch für ein breiteres Publikum verzehrfähig zu machen, um so eine große Quelle tierischen Proteins schmackhaft werden zu lassen? Auf den ersten Blick erscheint diese Versuchsküche bei all ihren Farnen, Moosen und Wildkräutern wie die eines Alchimisten, aber hier wird mit moderner Technik an kulinarischen Antworten für die Welt von morgen gearbeitet.
Vielleicht liegt in diesem Antrieb ein ureigener Geist des Protestantismus verborgen: den Genuss selbst produktiv werden zu lassen. Das „Noma“ und René Redzepi sind lediglich die prominentesten Vertreter einer neuen Avantgarde der eine breitere Beachtung und Diskussion gebührt als lediglich zwischen den engen Rändern eines Tellers.
Mehr auf Tartuffel
Bücher: Luxus
Charaktere: Cook it raw
Köpfe: Dollase
Zutat: Geist