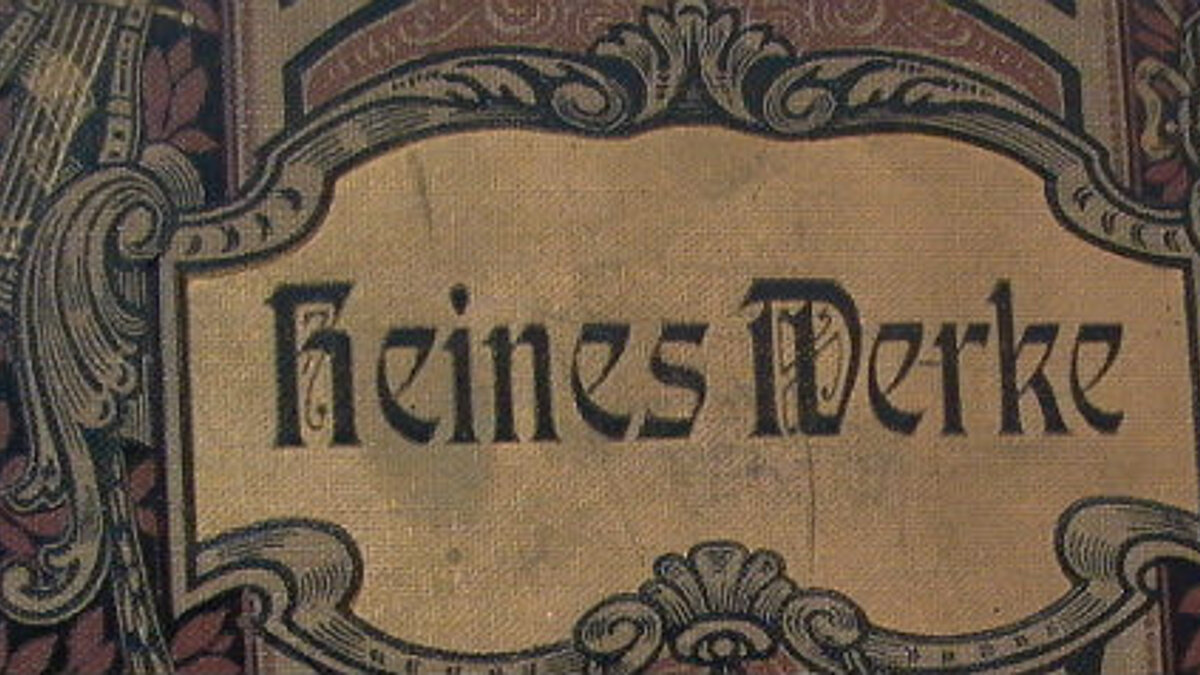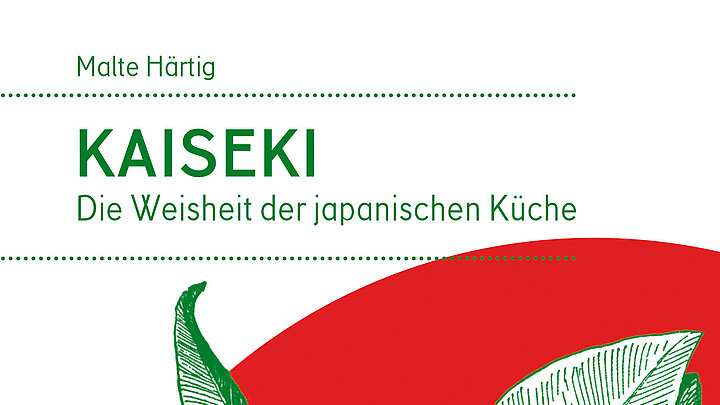Für Heinrich Heine oder Der Schalet
Jüdische Küche aus Dichtermund
Wieder einmal hatte ich nicht widerstehen können: Das kleine Antiquariat um die Ecke übte eine zu große Anziehungskraft auf mich aus. Welche Wohltat, sich in diese Oase des Geistes zurückzuziehen, abzuschalten von den Mühen der Ebene, den Lärm der Welt auszusperren, den Alltag für einen Moment zu vergessen ... Buchrücken reihte sich an Buchrücken, alles, was Rang und Namen hatte, war hier auf fünfunddreißig Quadratmetern versammelt. Wie nicht anders zu erwarten, verlor ich in kürzester Zeit die Kontrolle über meine Handlungen und hatte im Handumdrehen einen beträchtlichen Bücherstapel vor mir aufgetürmt. Krönenden Abschluß und Höhepunkt des Fischzugs bildete die „Neue Illustrierte Ausgabe“ der Werke Heinrich Heines in zwei großformatigen Bänden von Gustav Karpeles.
Diese „Neue“ Ausgabe war nun mittlerweile auch mehr als hundert Jahre alt, aber welche Pracht bot sich mir dar! Zwar stand längst eine mehrbändige Heine-Ausgabe in meinem Bücherschrank und auch diverse Einzelbände seiner Werke hatte ich im Laufe der Zeit immer wieder nach Hause getragen, doch ich zögerte keinen Augenblick – die schaurig schönen Illustrationen, angesiedelt zwischen Kitsch und Jugendstil, hatten es mir angetan! Heimgekehrt, zog ich mich mit meinen Schätzen in mein Zimmer zurück.
Prinzessin Sabbat
Wer war da nicht alles zu sehen – die schöne Wasserfee, Prinzessin Ilse vom Ilsenstein, die liebliche Sara, Siegfried mit dem Drachen, Napoleon oder die Götter Griechenlands ... Und dann kam, was kommen mußte: Zunächst blätterte ich in den Bänden, wollte all die Jungfern und Jünglinge, die Helden und Fabelwesen betrachten, dann las ich hier eine Strophe und dort ein Gedicht, um mich schließlich ganz in Heines Dichtung zu verlieren. Jetzt interessierten auch die Illustrationen nicht mehr, es galt nur noch des Dichters Wort, das lebendig und frisch von den vergilbten Seiten emporstieg. Immer wieder konnte ich seine Verse und seine Prosa lesen und bekam nie genug davon. Als ich aber beim Gedicht von der „Prinzessin Sabbat“ angekommen war, gab es für mich kein Halten mehr. Ich griff zu Portemonnaie und Einkaufskorb, lief zum nächsten Laden und besorgte alles Erforderliche für meinen schnell gefassten Plan. Dann holte ich den gusseisernen Topf aus dem Schrank und ging ans Werk. Zu verlockend war mir der Duft des Schalet aus den Versen in die Nase gestiegen:
„Schalet, schöner Götterfunken, Tochter des Elysium! Also klänge Schillers Hochlied, hätt er Schalet je gekostet. Schalet ist die Himmelsspeise, die der liebe Herrgott selber einst den Moses kochen lehrte auf dem Berge Sinai.“
Als am Abend die Familie um den Tisch versammelt war und in der Schüssel der unvergleichliche Schalet dampfte, hätte sich niemand gewundert, wäre der Dichter plötzlich zur Tür hereinspaziert. Und da er sein Leben lang alles andere als ein Asket gewesen war, hätte er ganz sicher eine Flasche Wein auf den Tisch gestellt, Rheinwein vielleicht, eher wohl zwei, und sich bestimmt mit Freuden zu uns gesetzt. Dann wäre über vieles zu reden gewesen, ganz sicher nicht nur über den Schalet ...
Wer es mir gleichtun möchte, hier das Rezept für Schalet, Tscholet oder Tscholent, das traditionell zum Schabbat zubereitet wurde und auch heute noch zum Repertoire der jüdischen Küche gehört. Schreibweise wie auch Zubereitungsart variieren je nach Gegend.
Was übrigens die Schreibweise betrifft, so überliefert die begnadete Geschichtenerzählerin Salcia Landmann folgenden Witz:
„Tate (jidd.: Papa), wie schreibt man Tscholet?“
„Tscholet schreibt man nicht, Tscholet eßt man!“
Die Zutaten
- 1 kg fettes Rindfleisch
- 4-5 fein gewürfelte Zwiebeln
- 2-3 Tassen einige Stunden zuvor eingeweichte Linsen
- 1,5 Tassen Perlgraupen
- Öl zum Anbraten, Salz, Pfeffer, je nach Geschmack auch Knoblauch
Zunächst wird das Fleisch im Öl angebraten, dann werden die Zwiebeln hinzugegeben und glasig geschmort, danach ordnet man abwechselnd Linsen und Graupen um das Fleisch herum an, salzt und pfeffert und gibt ausreichend (heißes) Wasser hinzu, bis alles großzügig mit Flüssigkeit bedeckt ist (das Wasser sollte 2 bis 3 cm über den Zutaten stehen). Nun wird alles zum Kochen gebracht, der Topf verschlossen und das ganze 2-3 Stunden bei schwacher Hitze geschmort. Statt der Linsen können auch weiße Bohnen oder Erbsen verwendet werden, statt des Rindfleischs ein fettes Stück von der Gans und statt der Graupen Reis.
Welche Variante Heinrich Heine bevorzugte, ist leider nicht überliefert.
Guten Appetit!
Hinzuzufügen wäre noch eine Episode, die veranschaulicht, dass die Zubereitung von Tscholet eine wahre Weltanschauung ist, unterscheidet sie sich doch von Region zu Region:
Eines Tages fragte mich mein damals neunzigjähriger, aus Böhmen stammender, Onkel, der bereits mehr als fünfzig Jahre in Rom lebte, in Italien also, mit seiner göttlichen Küche:
„Kannst Du eigentlich auch Tscholent kochen?“
„Aber klar!“
„Dann gibt es morgen Tscholent. Habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gegessen.“
Sicherheitshalber erkundigte er sich einen Augenblick später:
„Woraus bereitest Du ihn denn zu?“
„Na ja, aus Rindfleisch, Linsen und Graupen.“
Den Gesichtsausdruck des Onkels hier wiederzugeben, erspare ich mir, seine Worte allerdings waren mehr als deutlich:
„Du liebe Güte!! Das ist ja eine völlig pervertierte Variante!“
Nachdem er sich von seinem Schock erholt hatte, erfuhr ich, daß seine Mutter für Tscholent ausschließlich ein fettes Stück von der Gans nahm..., weiße Bohnen und natürlich Reis!!! Etwas anderes wäre bei ihr niemals auf den Tisch gekommen. Versteht sich, daß das Tscholent-Mahl in Rom ausfiel ...
Lesetipp
Von Vera Bischitzky ist soeben eine neue Übersetzung eines Buches von Iwan Gontscharow im Aufbau Verlag erschienen, welches Sie als Herausgeberin betreut hat.
Vera Bischitzky (Hg.): Iwan Gontscharow: Herrlichste, beste aller Frauen. Leinen mit Banderole. 205 Seiten. 16,99€
Mehr auf Tartuffel
Charaktere: Oblomow im Schlaraffenland
Phänomene: Von Stinten, Stören und Sternhausen
Bücher: Oblomow kann nicht genießen
Bücher: Jüdische Küche