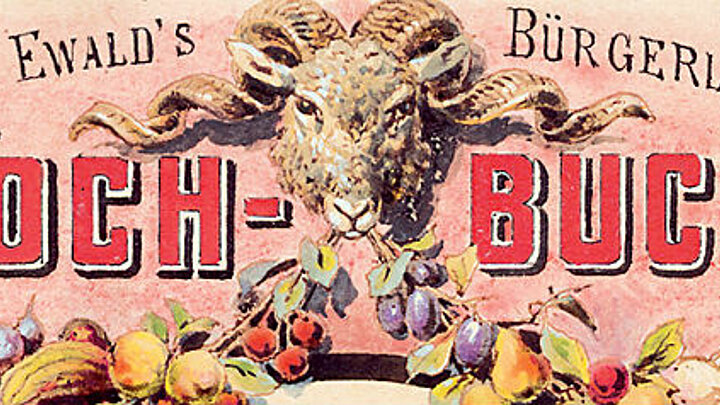Das täglich Brot ist nicht mehr sicher: Anstehen mit der Brotkarte | Bundesarchiv, Bild 183-R00012 / CC-BY-SA [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons
Vom Darben an der Heimatfront
Die Erfahrung des Hungers als Erbe für Generationen
Nicht allein in militärischer Hinsicht ist der Erste Weltkrieg für Deutschland ein Zweifrontenkrieg. Der Begriff beschreibt ebenso die Wechselbeziehung von Kriegs- und Heimatfront, vom Sterben im Graben und dem Darben und Hungern daheim. Diese Wechselbeziehung entwickelt eine Dynamik, die nach Hungerkrawallen und Soldatenaufständen letztlich das Ende von Monarchie und Krieg eines werden lässt.
Die Geschichte des Essens und vor allem Trinkens an der Front haben wir uns bereits von Ernst Jünger erzählen lassen. Nun wendet sich unser Blick dem Geschehen in den Städten und Dörfern des Hinterlandes zu. Für das kollektive Gedächtnis dieses Krieges, für das Tradieren von Werten und Maßstäben, von Sehnsüchten und Ängsten rund um das Essen ist dies sogar die wirkungsmächtigere Mechanik.
Von Kriegsbeginn an ist die Versorgungslage der Bevölkerung der Antrieb dieser Entwicklung. Denn die bereits im August 1914 von England betriebene Seeblockade trifft das Deutsche Reich empfindlich. Nicht nur der Verlust wichtiger Rohstoffe wiegt schwer. Als „Hungerblockade“ richtet sie sich explizit gegen die Zivilbevölkerung. Immerhin importiert Deutschland vor Ausbruch des Krieges rund ein Drittel seiner Nahrungsmittel. Die Konsequenzen beschreibt eine Anzeige für das Kriegskochbuch „Des Vaterlandes Kochtopf“ klarsichtig: „Die Küchenfrage ist jetzt eine Bewaffnungsfrage geworden. Die Abwehr gegen Englands Aushungerungsplan ist sein geistiger Vater, das frauenzimmerliche Vergnügen am Beherrschen des Materials seine seelische Mutter. – Drei Mittagsmahlzeiten bleiben fleischlos; das Abendessen sei fast – eine brotlose Kunst!!“
Mangel und Teuerung
Da die heimische Landwirtschaft den Importausfall nie kompensieren kann, bestimmt eine Mangelwirtschaft mit zugeteilten Rationen und Lebensmittelkarten, mit immer mehr Ersatzlebensmitteln und immer findigeren Zubereitungsarten für die noch verfügbaren Nahrungsmittel den Kriegsalltag der Zivilbevölkerung.
Der Romanist Victor Klemperer hält in seinem Tagebuch für den 14. August 1914 fest: „Aufruf des Ministeriums, Schwarzbrot zu essen, nicht Weißbrot. Weil wir im Frieden Roggen exportierten, Weizen einführten.“ Und er bemerkt, dass die Ernährungslage immer auch als Zustandsbeschreibung des ganzen Landes wahrgenommen wird: „Die Dame antwortete: ‚Ja, aber haben Sie die Verordnungen des Bundesrats und den Protest der Bäcker gelesen? Streckung der Mehlvorräte und Verbot, in der Nacht zu backen. Wenn es so um uns steht ...’“
Und es steht „so“ um die Versorgungslage. Zum Übel des Mangels gesellt sich das der Teuerung. In den ersten neun Monaten nach Kriegsausbruch steigt der Preis für Lebensmittel um etwa 65 Prozent. Im Mai 1915 erschüttern die sogenannten Butter-Krawalle Berlin. Der handgreifliche Protest der Menge endet erst mit der Festsetzung eines deutlich gesenkten Höchstpreises. Ähnliche Krawalle finden in weitere Städten des Kaiserreichs statt, Victor Klemperer notiert für München „einen Frauenkrawall zur Erzwingung zusätzlicher Brotkarten“.
Der geisteskranke „Steckrübenwinter“
Höhepunkt der Hungerhistorie ist der „Steckrübenwinter“ von 1916/17, als die verhasste „Hindenburg-Knolle“ zum ausschließlichen Grundnahrungsmittel wird und sich die Variationen auf Steckrübensuppe, Steckrübenauflauf, Steckrübenkoteletts, Steckrübenpudding, Steckrübenmarmelade oder Steckrübenbrot beschränken. Die Menschen leben von rund 1000 Kalorien pro Tag, der Hunger zermürbt die Bevölkerung, schürt Unzufriedenheit und offenen Protest. Der depressiven Höhepunkt dieser Not grenzt nach Victor Klemperer gar an Geisteskrankheit. „Bis hierhin hatte ich die zahlreichen Eßnotizen meines Tagebuchs im wesentlichen mit dem darüberstehen des Kulturhistorikers niedergeschrieben. Ich hatte mir oft auch für meinen Teil eine bessere Kost gewünscht [...] aber ich hatte doch noch nie wirklich gehungert, ich war noch nie von Eßvorstellungen besessen gewesen.“
Das Trauma des „Steckrübenwinters“ wird sich 1946/47 wiederholen – doch das ist ein anderer Krieg. Die Steckrübe wie auch die Graupen oder das Dörrobst entsprechen dem letzten Aufgebot der heimischen Landwirtschaft. Die Schmähung, die damit verbunden ist, legen diese Nahrungsmittel die kommenden hundert Jahre nicht ab. In ihnen, so das kollektive Gedächtnis, schmeckt das Trauma bis heute nach.
Ein weiteres Phänomen sind die Ersatzlebensmittel, die aus Mangel und mit beeindruckender Kreativität entstehen. Am Ende des Krieges sind über 10.000 solcher Surrogate bekannt. Darunter Brote aus Mais- oder Kartoffelmehl, Kaffee aus Getreide oder Buchweizen, Wurst aus Soja, aber auch Maiskeim- und Leinsamenöl, Kunsthonig ... Produkte, von denen einige in den Zeiten von Vegetarismus und Lebensmittelunverträglichkeiten wieder an Attraktivität gewonnen haben. Damals beurteilen die Menschen das deutlich anders, wie Stefan Zweig bekundet.
„Das Brot krümmelte sich schwarz und schmeckte nach Pech und Leim, Kaffee war ein Absud von gebrannter Gerste, Bier ein gelbes Wasser, Schokolade gefärbter Sand, die Kartoffeln erfroren ...“.
Mitunter nimmt das Ersatz-Denken recht bizarre Formen an, wenn beispielsweise aus Maikäfern Fett gewonnen werden soll. Und Victor Klemperer konstatiert: „in Berliner Blättern annoncierten ‚Feinkosthandlungen’, die früher Delikateßgeschäfte geheißen, ‚junge Saatvögel’, die früher Krähen geheißen hatten.“
Sprachspuren im Hinterland
Der Philologe verweist damit auf eine weitere Einschreibung in das kollektive Gedächtnis – die der Sprache. Da sind zum einen neue Begrifflichkeiten wie „Steckrübenwinter“, „Butter-Krawall“, „Schweine-Mord“, „Lebensmitteldiktator“, die Eingang in Publizistik und allgemeinen Sprachgebrauch finden. Dazu zählen aber auch die bitter ironischen Prägungen wie „Drahtverhau“ , „Hindenburg-Knolle“ oder „Graupenauer“, in denen sich das eigentliche Werturteil der Bevölkerung ausdrückt.
Klemperer macht zudem auf die Eindeutschung von ursprünglich dem Französisch entlehnten Begriffen aufmerksam, die vor dem Krieg noch zum ausgemachten guten Ton zählten. Aus Delikatessen wird Feinkost, aus der Pension ein Fremdenheim und aus dem Restaurant eine Gaststätte. Frankreich ist der Feind und der muss selbst in der Sprache dahin gemacht werden. Mit solcher Attitüde lässt sich sogar der hausgemachte Mangel übertünchen, so findet sich 1916 auf der Speisekarte der Deutschen-Eisenbahn-Speisewagen-Gesellschaft folgende Erläuterung: „Soweit die in diesem Preisverzeichnis angebotenen Erzeugnisse aus dem Feindesland stammen, werden sie nach ihrem Aufbrauch durch deutsche Waren in angemessener Beschaffenheit und Preislage ersetzt werden.“
Auch andere deutsche Begriffe bekommen plötzlich Konjunktur. Erneut hält Victor Klemperer für uns fest:
„... ‚ich habe hier den Krieg von einer neuen Seite kennengelernt: von der Hamsterseite.’ Und wirklich sind mir Wort und Sache erst hier aufgegangen. Natürlich hatte ich hamstern für Vorräte speichern schon vor dem Kriege gekannt: da war es ein bildlicher und poetischer Ausdruck ohne feststehende moralische Wertung gewesen. Wer wie ein Hamster sammelte, konnte ebenso gut ein vorsichernder Hausvater wie ein habgieriger Geizhals sein. In der Spezialbedeutung und Wertung, die es während des Weltkriegs enthielt, hatte ich hamstern sicherlich auch schon ein paar Mal nennen hören, doch kaum vor meiner Rückkehr aus Kowno. Aber ganz aufgegangen, ganz geläufig geworden ist es mir erst in Driburg, wo sich mancher Leute Leben darum drehte und wo man kein Gespräch führen konnte, ohne darauf zu stoßen. Jetzt hieß hamstern das dem Volksinteresse zuwiderlaufende, das unsittliche und verbotene Aufspeichern von Vorräten, die an eine Vielzahl hätten verteilt werden sollen.“
Überlebenstechniken gegen den Hunger
Begriffe wie „Hamstern“ aber auch „Schieben“ oder „Schleichhandel“ zeichnen eine weitere Frontlinie dieses Krieges: die Grenze zwischen jenen, die ihre Quellen haben, um Lebensmittel jenseits der Brot- und Butterkarten zu besorgen, und jenen anderen, die von den erst genannten teuer kaufen müssen. Dahinter verbirgt sich auch die Unterscheidung von Stadt und Land, wo die Stunde geschäftstüchtiger Bauern und wanderfreudiger Städter schlägt, wie Stefan Zweig aus Österreich berichtet.
„Besser stand es am flachen Land mit der Ernährung; bei dem allgemeinen Niederbruch der Moral dachte kein Bauer daran, seine Butter, seine Eier, seine Milch zu den gesetzlich festgelegten ‚Höchstpreisen’ abzugeben. Er hielt, was er konnte, in seinen Speichern versteckt und wartete, bis Käufer mit besserem Angebot zu ihm ins Haus kamen. Bald entstand ein neuer Beruf, das sogenannte ‚Hamstern’. Beschäftigungslose Männer nahmen ein oder zwei Rucksäcke und wanderten von Bauer zu Bauer, fuhren sogar mit der Bahn an besonders ergiebige Plätze, um illegal Lebensmittel aufzutreiben, die sie dann in der Stadt zum vierfachen und fünffachen Preis verhökerten.“
Die Überlebenstechniken des Hamstern und des Schleichhandels setzen sich nach Kriegsende fort und wiederholen sich gleich dem Trauma von Steckrübe und Graupen noch einmal knapp dreißig Jahre später. Das ist wieder dieser zweite Krieg, jener, der noch folgen wird, und dessen Augen- und Gaumenzeugen unser „Schlachtbankett“ noch zu Tisch bitten wird.
Geschmacksprobe für Generationen
Aus der Sicht des Ersten Weltkriegs sind dies Wiederholungen. Im kulturellen Gedächtnis bestätigt die Reprise des Zweiten Weltkrieg aber nicht nur die Erfahrungen von Mangel, Hunger und Elend, vertieft sie nicht nur die Schmählegenden von Steckrübe und Graupe. Diese Wiederholung legt sich über ihr Original, gibt eigene Prägungen mit, arbeitet – aus zweifelhaften Beweggründen – an der Legendenbildung weiter. Es ist nicht zuletzt die Erfahrung des Hungers und der aus Not sich widersetzenden Bevölkerung, weshalb Adolf Hitler der Ernährungslage der Deutschen stets hohe Aufmerksamkeit widmet. Wie Ernst Jünger die eroberten Stellungen plünderte, um mal gut essen zu können, so lässt der oberste deutsche Kriegsherr des Zweiten Weltkriegs die eroberten Gebiete systematisch ausplündern, um Nahrungsmittel – und viele andere Werte – zur Befriedigung der Heimatfront nach Deutschland zu schaffen.
Vielleicht werden auch deshalb die Erzählungen der Überlebenden-Generation des Zweiten Weltkriegs immer auch als stumm sich entschuldigende Buße vorgebracht. Erst aus dieser doppelten Motivlage von Hunger und Schuld erklärt sich das große Fressen der Wirtschaftswunderjahre – aber letztlich auch die spätere bundesrepublikanische Rückbesinnung auf französische Kochkunst und die offene Orientierung an diesen neuen, alten Vorbildern.
Und – vielleicht zuviel gewagt an dieser Stelle – erst nach diesem Abarbeiten am alten, verdrängten Vorbild kann sich die Kulinaristik in Deutschland emanzipieren und jenen originären Stellenwert entwickeln, den sie heute mit Recht beanspruchen kann.
Lektüre Tipp
Victor Klemperer, Curriculum vitae, Erinnerungen 1881 – 1918,
Bei Amazon zu erwerben
Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers


![Geschichte in mehreren Gängen zum verschlingen aufgetragen | © Von Tnarik - Flicr [1], CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2547841 Geschichte in mehreren Gängen zum verschlingen aufgetragen | © Von Tnarik - Flicr [1], CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2547841](/fileadmin/_processed_/1/b/csm_Cocido_9df4118533.jpg)